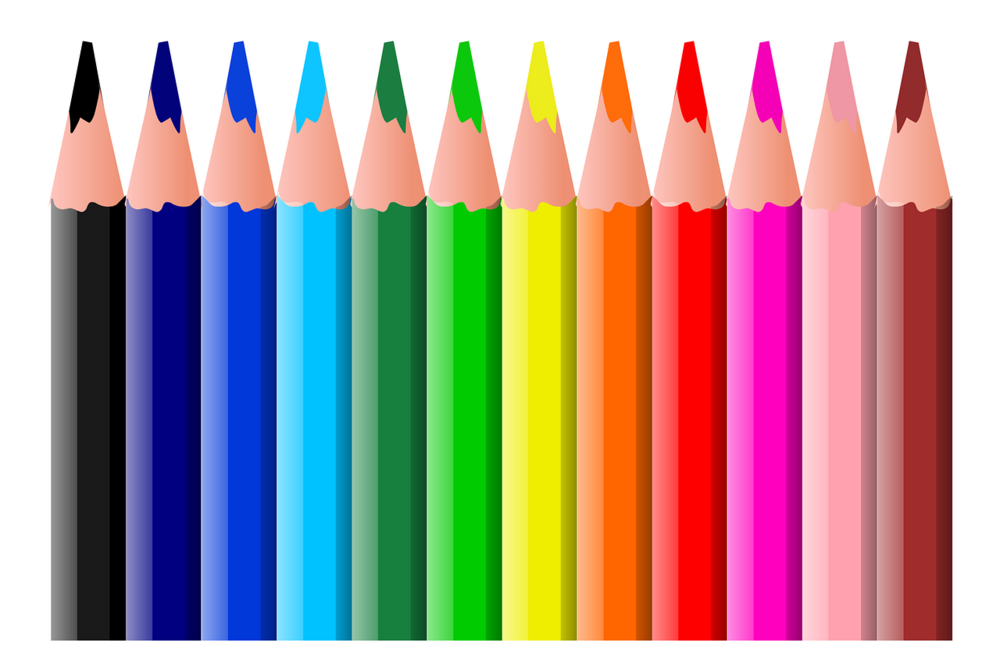
Nikolausschule Waldorf – GRÜNE wollen das pädagogische Konzept sichern.
19.08.22 –
Auf der letzten Schulausschusssitzung wurde von der Verwaltung eine Ausblick auf die Entwicklung der Schüler*innenzahlen in Bornheim für das nächste Schuljahr 2023/24 gegeben. Wenig überraschend deutete sich dabei ein Überhang an Schüler*innen im Sozialraum Waldorf/Kardorf/Dersdorf ab, so dass über Lösungen dort nachgedacht wurde. Etwas überraschend wurde von der Schulaufsicht eine Aufstockung der Klassengrößen an der Nikolausschule auf 28 oder 29 Schüler*innen vorgeschlagen. Dies würde allerdings das pädagogisch-didaktische Modell der Schule mit jahrgangsübergreifenden Klassen gefährden, wie auch die Schulleiterin in der Ausschusssitzung bestätigte. Zudem wiederspricht eine solche Reglung der Verordnung zum Schulgesetz, die bei jahrgangsübergreifenden Konzepten eine Klassengröße von 25 festsetzt.
„Das Konzept der Nikolausschule muss erhalten und gesichert werden. Die Argumentation der Schulaufsicht ist für uns nicht nachvollziehbar. Zum einen scheint der jahrgangsübergreifende Unterricht mit seinen besonderen Chancen aber auch Herausforderungen bei der Anregung der Schulaufsicht nicht berücksichtigt worden zu sein, zum anderen könnte durch eine Aufstockung der Klassen in Waldorf ein Ungleichgewicht in der Verteilung der Schüler*innen innerhalb Bornheims die Folge sein, was wiederum rechtlich angreifbar wäre. Es kann nicht als Ergebnis am Ende stehen, dass wir in einem Ort Klassengrößen von 29 haben, in einem anderen von 19. Einer solchen Lösungen könnten wir nicht zustimmen“ erklärt der schulpolitische Sprecher der GRÜNEN Fraktion, Manfred Quadt-Herte.
Die GRÜNEN bekennen sich dabei zu dem Grundsatz „Kurze Beine, kurze Wege“ aber nicht als Argument, um damit in einigen Ortsteilen größere Klassen umzusetzen, sondern als Handlungsmaxime für den Schulträger, also die Stadt Bornheim, wohnortsnah ausreichend Schulplätze zur Verfügung zu stellen.
„Für die von der Verwaltung beschriebene Problematik an den Grundschulen 2023/24 erscheint uns daher als beste Option für Kinder und Eltern das Aufstellen von Containern an der Nikolausschule als Übergangslösung. Für eine perspektivische Erweiterung der Schule hin zur Dreizügigkeit, muss aber auch der Raum geschaffen werden und der dringende Neubau der Kita Flora vorangetrieben werden. Zudem fordern wir eine zeitliche Perspektive für die Gesamtplanung des Areals Nikolausschule/Kita Flora, denn das Aufstellen der Container nimmt den Kindern in den Pausen Platz um sich zu bewegen. Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern sollten im Vorfeld über Umfang und Dauer dieser Übergangslösung bestmöglich aufgeklärt werden“ so der familienpolitische Sprecher, Markus Hochgartz.
Kategorie
#Familie | #Fraktion | #Jugend | #Kitas | #Presse | #Schulen | #Stadtentwicklung | #Waldorf
Im Klimapaten-Netzwerk sind aktuell etwa 150 Bürgerinnen und Bürger der linksrheinischen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises organisiert, die zeigen, dass
- im privaten Bereich
- in Betrieb und Unternehmen
- in Vereinen und Organisationen
vieles gegen den Klimawandel getan werden kann.
Das Netzwerk existiert seit 2011 und hat einen großen Schatz an Erfahrungen gesammelt, die allen Interessierten zur Verfügung stehen, egal ob es um PV-Anlagen, Windräder oder klimaneutrales Bauen geht.
Zahlreiche Publikationen sowie Kontaktdaten finden sich auf der Homepage des Klimapaten-Netzwerks.
Was sind die Haupttreiber des Klimawandels?

Haupttriebfeder des Klimawandels ist der Treibhauseffekt. Einige in der Erdatmosphäre vorhandene Gase wirken ungefähr wie das Glas eines Gewächshauses: Sie lassen Sonnenwärme zwar herein, verhindern aber ihre Abstrahlung zurück in den Weltraum und führen zur Erderwärmung.
Viele dieser Treibhausgase sind natürliche Bestandteile der Erdatmosphäre; infolge menschlicher Tätigkeiten ist jedoch die Konzentration einiger Gase stark angestiegen. Das gilt insbesondere für:
- Kohlendioxid (CO2)
- Methan
- Distickstoffoxid
- fluorierte Gase
Durch menschliche Tätigkeiten entstehendes CO2 trägt am stärksten zur Erderwärmung bei. Bis 2020 war die CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf einen Wert von 48 % über dem vorindustriellen Niveau (vor 1750) gestiegen.
Andere Treibhausgase werden durch menschliche Tätigkeiten in geringeren Mengen emittiert. Methan ist ein stärkeres Treibhausgas als CO2, hat aber eine kürzere Lebensdauer in der Atmosphäre. Distickstoffoxid ist wie CO2 ein langlebiges Treibhausgas, das sich in der Atmosphäre über Jahrzehnte und Jahrhunderte anreichert.
Natürliche Ursachen wie etwa Veränderungen der Sonneneinstrahlung oder vulkanische Aktivität haben zwischen 1890 und 2010 Schätzungen zufolge um weniger als ± 0,1 °C zur Gesamterwärmung beigetragen.
Ursachen für steigende Emissionen
Bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas entstehen Kohlendioxid und Stickoxide.
- Abholzung von Wäldern (Entwaldung). Bäume tragen durch Aufnahme von CO2 zur Klimaregulierung bei. Durch Rodung geht diese positive Wirkung verloren, und der in den Bäumen gespeicherte Kohlenstoff wird in die Atmosphäre freigesetzt, wo er zum Treibhauseffekt beiträgt.
- Intensivierung der Viehzucht. Kühe und Schafe erzeugen bei der Verdauung ihres Futters große Mengen an Methan.
- Stickstoffhaltige Dünger verursachen Stickoxidemissionen.
- Fluorierte Gase werden aus Geräten und Produkten freigesetzt, in denen diese Gase verwendet werden. Diese Emissionen haben einen sehr starken Treibhauseffekt, der bis zu 23 000-mal stärker ist als der von CO2.
Quelle: https://ec.europa.eu/clima/change/causes_de
Kosten des Klimawandels
Das Bundesumweltamt berechnet die Auswirkungen von Umwelt- und Klimaschäden und damit, was fehlender Klima- und Umweltschutz kosten.
Das Pariser Klimaabkommen von 2015
Das Übereinkommen von Paris ist die erste umfassende und rechtsverbindliche weltweite Klimaschutzvereinbarung und wurde im Dezember 2015 auf der Pariser Klimakonferenz geschlossen.
Zu den fast 190 Vertragsparteien des Pariser Übereinkommens zählen auch die EU und ihre Mitgliedstaaten. Die EU hat das Übereinkommen am 5. Oktober 2016 formell ratifiziert.
Was heißt eigentlich "klimaneutral"?
Das Europäische Parlament hat folgende Erklärung dazu veröffentlich.
CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze



